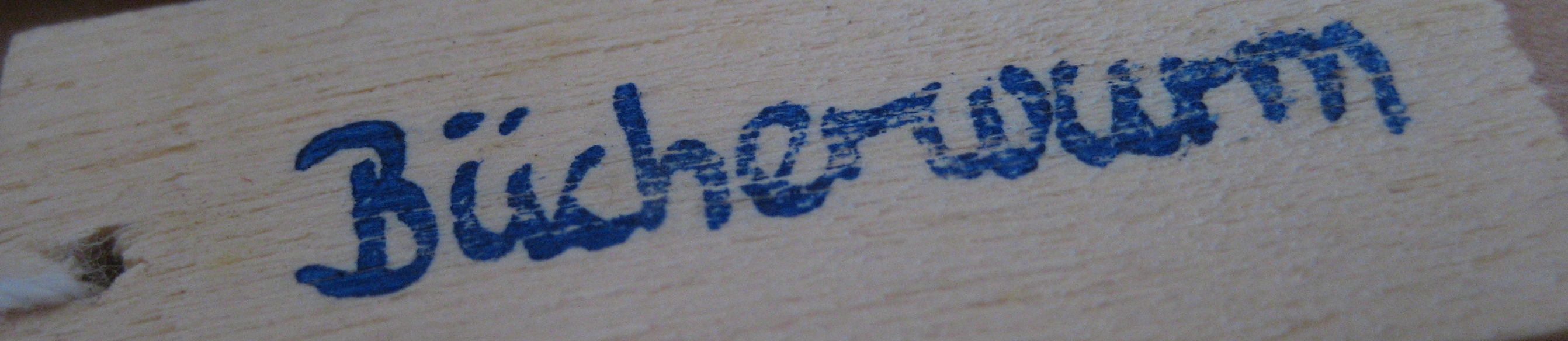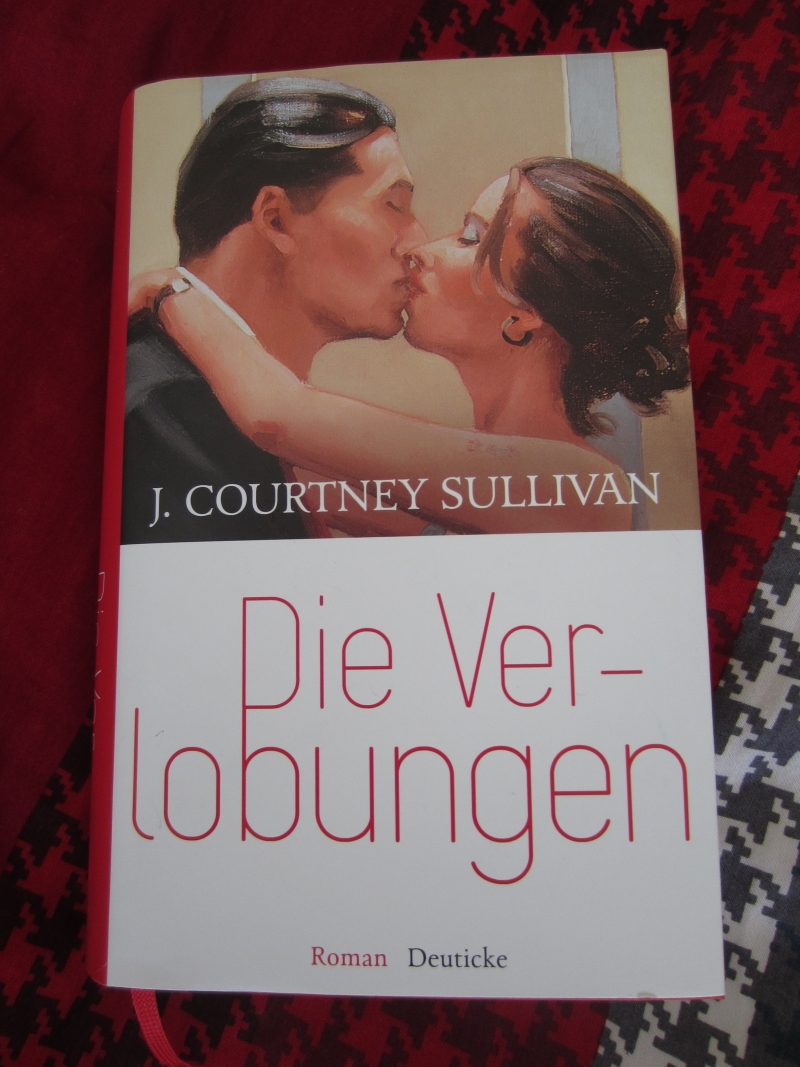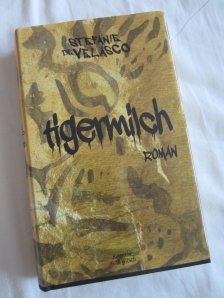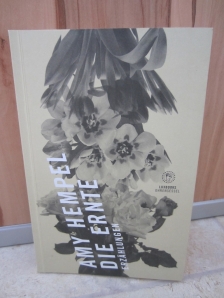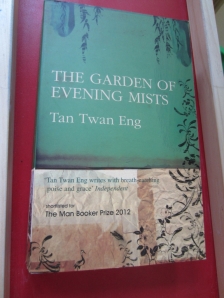„Irgendwie war es einfacher, einen Menschen zu lieben, der nicht da war“
„Irgendwie war es einfacher, einen Menschen zu lieben, der nicht da war“
„Gleich werden Sie einem fremden Volk in einem fremden, feindlichen Land begegnen. Halten Sie sich unbedingt von den Deutschen fern. Gehen Sie auf der Straße nicht neben ihnen, schütteln Sie ihnen nicht die Hand, besuchen Sie sie nicht in ihren Wohnungen.“ So lauten die Anweisungen, die Rachael und die anderen Gattinnen der britischen Offiziere erhalten, als sie kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland eintreffen – zum Zweck der Familienzusammenführung. Rachael kommt mit ihrem jüngeren Sohn Edmund zu ihrem Mann Lewis nach Hamburg – ihr älterer Sohn Michael ist durch deutsche Bomben gestorben, und Rachael ist sehr labil. Es behagt ihr gar nicht, dass der tolerante Colonel Lewis ein eigenartiges Arrangement getroffen hat: Da das Haus an der Elbe, in dem die britische Familie einquartiert wird, derart groß ist, lässt er den deutschen Besitzer Stefan Lubert und seine Tochter Frida auch darin wohnen. Die Ehe ist nach all der Zeit, die Rachael und Lewis getrennt verbracht haben, und all den Strapazen, die sie im Krieg erdulden mussten, stark belastet – die beiden finden keinen Weg, miteinander zu reden. Doch da gibt es ja einen anderen Mann in Rachaels Nähe: den Deutschen Stefan Lubert. Und Lewis bekommt eine attraktive neue Übersetzerin …
Rhidian Brook versetzt mich mit seinem Roman Niemandsland genau dorthin: in ein Land, das zur Gänze zerstört ist, zerbombt, zermürbt, in dem nur noch Gespenster leben und das von Fremden beherrscht wird. Diese Fremden – im vorliegenden Fall die Engländer in der britischen Besatzungszone – stehen im Fokus des Buchs. Der Krieg ist vorbei und die britischen Soldaten versuchen ihr Möglichstes, um Herr über das Chaos zu werden, das sie in Deutschland vorfinden. Wer war ein Nazi, wer ein Mitläufer, wer ein Opfer? Und wie sollen sie es erkennen? Auch in ihren eigenen Reihen ist die Vorgehensweise umstritten. Colonel Lewis Morgan gehört zu jenen, die den Deutschen möglichst schnell ihre Souveränität und ihr Land zurückgeben wollen. Er redet mit den Deutschen, obwohl er das nicht soll, gibt den bettelnden, halb verhungerten Kindern Zigaretten und lässt den Besitzer seines besetzten Hauses weiterhin darin wohnen. Damit macht er sich keine Freunde bei den anderen Soldaten. Und auch mit seiner Frau, die er jahrelang vermisst hat, läuft es alles andere als rosig: Sie haben sich völlig voneinander entfremdet. Dieses Gefühl, fremd zu sein in allen Belangen, hat Rhidian Brook bestens eingefangen: Er porträtiert Rachael und Lewis, lässt sie abwechselnd erzählen und zeigt, wie einsam und verloren sie sind – mitten im Niemandsland.
Dies ist ein recht episches, gut geschriebenes, aber stellenweise auch sehr konstruiertes Buch. Es soll, so sagt es der Klappentext, von Ridley Scott verfilmt werden – und das kann ich mir gut vorstellen. Es wirkt zum Teil schon wie ein Film, mit in sich geschlossenen Szenen und verträumten Bildern. Das soll freilich kein Nachteil sein, schien mir aber beim Lesen manchmal ein wenig hölzern und nicht so lebendig, wie es hätte sein können. Generell aber gibt es an Niemandsland nichts auszusetzen. Es ist ein atmosphärischer, leicht zu lesender und sehr gefühlvoller Roman, der sich in eine Zeit einklinkt, in der alles tot und begraben war und in der die Menschen ihr Leben neu aufbauen mussten. Da steckt freilich viel Pathos und viel Potenzial für dramatische Momente drin, was Rhidian Brook teilweise voll ausnutzt und teilweise elegant umschifft. Sein Vater und Onkel haben die Besatzungszeit in Deutschland selbst miterlebt, ihre Erlebnisse lieferten die Basis für das Buch: Rhidian Brooks Großvater hat tatsächlich mit einem Deutschen in einer konfiszierten Villa gelebt. Aus dieser wahren Geschichte hat der Autor einen sehr lesenswerten und authentischen Schmöker gemacht.
Niemandsland von Rhidian Brook ist erschienen im Bertelsmann Verlag (ISBN 978-3-570-10128-5, 384 Seiten, 19,99 Euro).
Was ihr tun könnt:
Ein Video mit dem Autor anschauen.
Eine sehr positive Besprechung in der Zeit lesen.
In dieser Rezension einiges über die Hintergründe und Brooks eigene Familiengeschichte erfahren.
Das Buch bei ocelot.de bestellen.