 „Gletschereis ist hier im Sommer schon lange keines mehr zu sehen“
„Gletschereis ist hier im Sommer schon lange keines mehr zu sehen“
Eine Fotografin macht sich auf den Weg in die Berge: Für einen Auftrag braucht sie Bilder, die das Schmelzen der Gletscher dokumentieren. Sie fotografiert für eine Umweltschutzorganisation das Heute, damit man es mit dem Gestern vergleichen kann, und trifft auf einen Professor, der seit fünfzig Jahren Messungen durchführt. Anhand seiner Daten und ihrer Bilder wird plötzlich klar: Da ist was faul. Das Schmelzen der Gletscher liegt nicht am Klimawandel allein. Aber was ist hier im Gange? Wer steckt dahinter und was haben die Drahtzieher dieser Verschwörung vor? Und warum musste eine Biologin auf dem Berg sterben? Die Fotografin macht sich auf die Suche nach Antworten – und schwebt bald selbst in größter Gefahr.
Das Setting klingt, als handle es sich bei Die Stille der Gletscher um einen Thriller, doch das ist nicht der Fall. Dazu schreibt die österreichische Autorin Ulrike Schmitzer, die Absolventin der Leondinger Akademie für Literatur ist und bereits zahlreiche Werke publiziert hat, erstens zu gut und zweitens zu ironisch. Es ist ein herrlicher Spaß, wenn der Fun- und Eventmanager der Fotografin die Erlebnismöglichkeiten für die Touristen auf dem Gletscher zeigt, wo es eine venezianische Gondel im Gletschersee und einen Skyglider gibt:
„Wir mussten den Sommer beleben, wenn der Winter wegbricht. Es braucht immer ein Highlight. Wandern ist eine mühsame Angelegenheit. Warum sollen wir dabei zusehen, wie die Gäste zu Fuß auf den Berg gehen, und wir haben nichts davon, haben sich die Bergbahnbetreiber gedacht.“
Vielleicht findet man das nur lustig, wenn man so nah dran ist wie wir Österreicher, wo sich bei uns alles ums Skifahren und um den Tourismus dreht – oder gar so nah wie ich, die ich jahrelang für Kunden wir Kitzsteinhorn Gletscher 3000, die Gasteiner Bergbahnen und den Nationalpark Hohe Tauern getextet habe: Ich habe so viel Werbung gemacht für all diese Events, damit Wanderer, Touristen und Urlauber kommen, um die Sensationen zu sehen, ich fühle mich vom euphorischen Funmanager quasi persönlich angesprochen. Und es ist ein Lachen, das im Hals stecken bleibt, weil das alles – die Bespaßung auf den sterbenden Gletschern, deren Tod wir Menschen verursachen – zutiefst pervers ist.
Einzigartig an Die Stille der Gletscher ist die Mischung aus realer Wissenschaft und fiktiver Geschichte, die Ulrike Schmitzer perfekt beherrscht. Das ist Information und Unterhaltung in einem. Man merkt an der Sicherheit, mit der sie schreibt, dass sie viel recherchiert hat, dass sie sich auskennt. Dem Buch sind zudem echte Fotos beigefügt, die das dokumentieren, was die Fotografin – die namenlose Ich-Erzählerin – mit ihrer Kamera aufnimmt: das Verschwinden des Gletschereises, das Gestern und das Heute. Die Geschichte nimmt rasant an Fahrt auf, ist spannend, bietet eine klassische Verschwörungstheorie, bleibt aber letztlich zu kurz und zu schmal, um wirklich Spannungsliteratur zu sein. Auf gerade einmal 140 Seiten lassen sich nicht mehrere Stränge entwickeln und zusammenführen, aber das ist auch nicht nötig: Das Buch will ja kein Thriller sein. Aufhorchen lassen will es, Interesse wecken, aufmerksam machen auf ein Umweltproblem, das per se unsexy ist: Mit dem Spaß ist es auf den Gletschern nämlich eigentlich vorbei. Davon wollen wir Menschen aber nichts hören, und wir wollen auch nichts dagegen unternehmen. Wir denken, das alles sei Zukunftsmusik, doch in Wahrheit hören wir schon längst das Lied des Todes. Ulrike Schmitzer hat ein kluges, böses, entlarvendes und vorausschauendes Buch geschrieben, das wie Fiktion anmutet – aber wenn sie mir sagte, dass jedes Wort davon wahr ist, dass alles so geschehen ist und geschieht, ich würde es sofort glauben.
Die Stille der Gletscher von Ulrike Schmitzer ist erschienen bei Edition Atelier (ISBN 978-3-903005-25-9, 144 Seiten, 18 Euro).
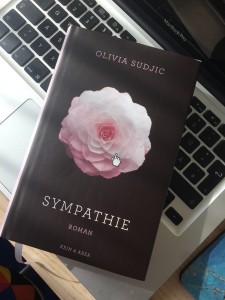 „E-Mail ist die Geißel unserer Zeit. E-Mail und Krebs“
„E-Mail ist die Geißel unserer Zeit. E-Mail und Krebs“ „Es ist nicht immer klar, wann man die Menschen trifft, die einem am meisten schaden“
„Es ist nicht immer klar, wann man die Menschen trifft, die einem am meisten schaden“ „Es war unmöglich, eine Auszeit von sich selbst zu nehmen“
„Es war unmöglich, eine Auszeit von sich selbst zu nehmen“ „Lasst uns auf unsere Freunde trinken und mögen wir alle mehr Freunde haben als Blätter an einem Apfelbaum“
„Lasst uns auf unsere Freunde trinken und mögen wir alle mehr Freunde haben als Blätter an einem Apfelbaum“ „Manchmal würde ich auch gern die Erinnerung verlieren“
„Manchmal würde ich auch gern die Erinnerung verlieren“ Ach, die Frauen! Immer wollen sie was.
Ach, die Frauen! Immer wollen sie was. „Und das Herz rollt sich ja auch nicht zum Sterben ein, es will immer noch und will und will“
„Und das Herz rollt sich ja auch nicht zum Sterben ein, es will immer noch und will und will“ „Wenn man einmal was erzählt hat, dann ist es da“
„Wenn man einmal was erzählt hat, dann ist es da“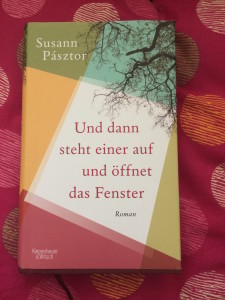 Begleitschreiben eines Sterbeprozesses
Begleitschreiben eines Sterbeprozesses