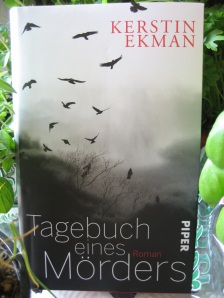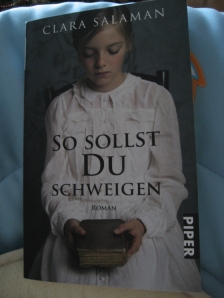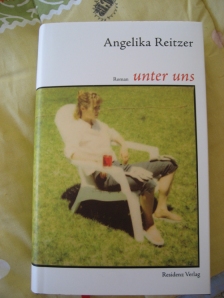Über die Moral und ihre krummen Beine
Über die Moral und ihre krummen Beine
In seinem Erstling Verbrechen berichtete der Berliner Strafverteidiger Ferdinand von Schirach in kurzen, prägnanten Geschichten von Fällen aus seinem Berufsleben. Nun soll der vielgelobte Bestseller verfilmt werden (und ich frage mich: wie?), und mit Schuld ist 2010 der Nachfolger erschienen. Ferdinand von Schirach setzt auf das bewährte Rezept, Fakten mit Fiktion zu vermengen und glaubhafte, schaurige kleine Berichte zu basteln. Er hat tagtäglich mit den Grausamkeiten zu tun, von denen er erzählt, und gibt dem Leser interessante Einblicke in die Tücken und Schlupflöcher unseres Rechtssystems. Die Stärke dieses Autors sind seine klugen Schilderungen, die punktgenauen Formulierungen, er ist kein Mann der vielen Worte und gebraucht nur genau so viel Fantasie wie nötig. Obwohl vieles im Detail dazuerfunden ist, glaubt man Ferdinand von Schirach, dass sich jede Geschichte genau so abgespielt hat wie von ihm beschrieben. Schuld befriedigt die voyeuristische Gier von uns Menschen nach Klatsch und Grusel gleichzeitig. Die Fälle in diesem Buch sind ebenso furchtbar wie unterhaltsam, der Ton ist ironisch, spöttisch, aber im rechten Moment sehr ernst. Schuld und Strafe stehen im Fokus, manche kommen ungeschoren davon, andere tragen die Konsequenzen ihres Tuns – und es ist interessant zu lesen, was weshalb geschieht. Gut gemacht.
Durchgekaut und einverleibt. Von diesem Buch bleibt …
… fürs Auge: ein sehr unpersönliches, fast schon groteskes Cover.
… fürs Hirn: Als Lektorin kann ich nicht umhin, darauf hinzuweisen, weil es in fast jeder Geschichte vorkommt: Das Wort Mädchen hat ein sächliches Geschlecht. Sätze wie “Das Mädchen sah zu den Jungs, während sie zwischen den Beinen ihrer Mutter stand” sind grammatikalisch falsch!
… fürs Herz: das Mitgefühl mit den Opfern.
… fürs Gedächtnis: die Geschichte über die Vergewaltigung.