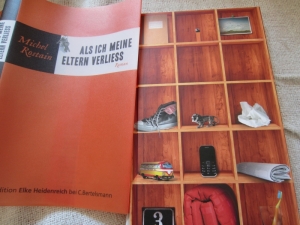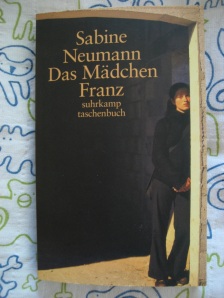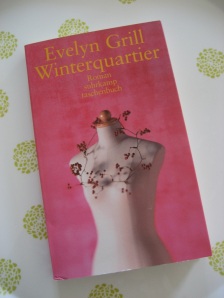Was wäre, wenn …?
Was wäre, wenn …?
“Sie ist nicht der erste Mensch auf diesem Planeten, der sich aus seinem Leben verabschiedet und neu anfängt, wie sie in ihrer Wahlheimat sagen. Sie ist nicht die erste Mutter, die ihre Kinder verlässt. So etwas passiert, und doch schockiert es uns, wenn wir davon erfahren.” Lydia ist aus England in die USA geflohen: 10 Jahre ist es her, dass sie ihren eigenen Tod vorgetäuscht und ihr altes Leben zurückgelassen hat. Sie hat sich selbst von ihrer Familie abgeschnitten, von ihren beiden Söhnen und von der englischen Krone. Denn früher einmal war Lydia die Prinzessin von Wales und die meistfotografierte Frau der Welt. Daran denkt sie nicht gern, und doch tut sie es jeden Tag. Ihr Sekretär Lawrence war ihr einziger Vertrauter, doch er ist lange schon tot. In der Kleinstadt Kensington hat sie sich etwas Neues aufgebaut, sie arbeitet in einem Tierheim, trifft sich mit Freundinnen und hat einen unspektakulären Alltag, der längst schon abgekühlt und gewöhnlich ist. Ihr Liebhaber heißt Carson und er spürt, dass sie etwas vor ihm verbirgt, doch wenn er sie danach fragt, weicht sie aus. Andererseits empfindet sie aber zu viel für ihn, um sich zu trennen: “Das Problem war nicht, dass er Fragen stellte. Das Problem war, dass sie sie beantworten wollte.” Und dann kommt Grabowski in die Stadt, ein Paparazzi, der Lydia einst auf Schritt und Tritt verfolgte, der Zufall führt ihn hierher. Er erkennt sie an ihren Augen. Lydia weiß, dass er sie verraten wird, und sie muss handeln.
Die gläserne Frau von Monica Ali ist ein bathtub-read: mit diesem Buch in den Händen in die wohlig warme Badewanne sinken und sich unterhalten lassen – perfekt. Dies ist ein typischer Frauenroman, angenehm leicht, sehr flüssig geschrieben, in einem gefälligen Stil. Es dauerte einige Zeit, bis mir die Parallelen im Leben von Protagonistin Lydia und der echten Prinzessin Diana auffielen – und noch einen Moment länger, bis mir klar wurde, dass sie Absicht sind. Die englische Bestsellerautorin Monica Ali hat sich überlegt: Was wäre, wenn Diana nicht tot wäre? Wo und wie könnte sie heute leben? Kein Autounfall war es – dieser kommt auch vor, ist aber nicht tödlich – , der sie das Leben kostete, sondern der eigene Wille: Sie taucht ab, zieht die Notbremse, rettet sich vor Depessionen, verräterischen Liebhabern und der Presse. Es passen allerdings nur die äußeren Umstände auf Lydia, Prinzessin Diana ist für mich nach wie vor eine eigenständige, andere Person. Deshalb ist Die gläserne Frau kein Biografieversuch und will das auch gar nicht sein. Vielmehr hat Monica Ali das Leben einer realen Person zum Anlass genommen, ihre Fantasie spielen zu lassen und eine spannende Geschichte zu kreieren, die trotz der unglaublichen Elemente nicht an den Haaren herbeigezogen ist. Ihr Schachzug, die Geschehnisse rund um Lydias Flucht anhand der Tagebucheinträge von Lawrence zu erzählen, ist genial – so muss sie sich nicht mit langen erklärenden Erinnerungen aufhalten. Ich habe ein komplett anderes Ende erwartet und bin von der Wendung überrascht, sehr zu meinem Wohlgefallen. Nichts spießt sich in diesem Roman, er ist wie ein Kinder-Pingui: etwas, das ich selten esse, ein bisschen zu süß eigentlich, aber manchmal, da muss man einfach ein Kinder-Pingui schlemmen. Am besten in der Badewanne.
Durchgekaut und einverleibt. Von diesem Buch bleibt …
… fürs Auge: ein richtig schönes, stilvolles Cover!
… fürs Hirn: die Fantasie wird angeregt durch die Frage: was wissen wir wirklich? Könnte nicht doch alles ganz anders sein?
… fürs Herz: der große Schmerz einer Mutter, die ihre Kinder verlassen hat. Die Literatur behandelt ja meist die Gegenseite – die einsamen und traurigen Kinder, die sich nach der Mutter sehnen.
… fürs Gedächtnis: die Erinnerung an die kleine leckere Unterhaltungssünde von zwischendurch.
Die gläserne Frau von Monica Ali ist erschienen bei Droemer Knaur (ISBN 978-3-426-19929-9, 384 Seiten, 19,99 Euro).