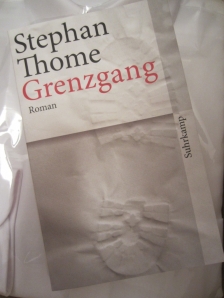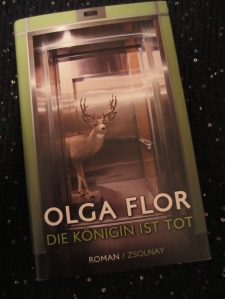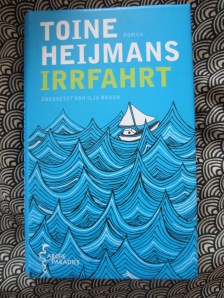„Sehnsucht gibt den Füßen Flügel“
„Sehnsucht gibt den Füßen Flügel“
„Wer kennt sich aus in dem verworrenen Fadenknäuel, das Rosies Leben gewesen ist?“ Der Armenvogt des kleinen Schweizer Dorfs hört sie sich an, die wilden Geschichten des jüngsten Zuwachses im Armenhaus: Rosie ist zurückgekehrt in ihre Heimat, eine alte, exzentrische, verlebte Person, die sich als einst berühmte Burlesque-Tänzerin sieht und wohl doch nie mehr war als eine gewöhnliche Hure. Von ihrem Ziehvater wurde das kleine Rösli Mitte des 19. Jahrhunderts als Kind fortgeschickt ins ferne Amerika, wurde von der Ziegenwiese gejagt und musste sich aufmachen ins Ungewisse. Sie kam nur bis England und begegnete dort ihrem Schicksal in Gestalt des widerlich-charismatischen Theodor Fairchild Lent, der das unschuldig-zarte Wesen aufnimmt in seine Kompanie. Deren Star ist Julia Pastrana, die Affenfrau, die Monstrosität, die Theodor in einer Stadt nach der anderen als Fehltritt der Natur zur Schau stellt. Aus Rösli wird Rosie la Belle, die Assistentin, die durch ihre Makellosigkeit die Entstelltheit von Julia noch hervorheben soll. Lohn gibt es für beide keinen, Fairchild bereichert sich am Unglück dieser beiden Kinder, die die anfängliche Distanz irgendwann überwinden und sich ein bisschen anfreunden. Die Leute im Dorf sind genervt von der rauchenden alten Dame in Schlangenlederpumps, aber der Armenvogt lauscht gern ihren Berichten, die vielleicht nicht einmal wahr sind: „Ich habe Menschen schon immer bewundert, die das Einfärben grauer Tage beherrschen. Sie federn dahin. Nichts drückt sie nieder. Ihnen gehört das Grün an ihrem Weg. Ihnen gehören die Berge am linken Ufer, die Berge am rechten Ufer und der See dazwischen. Der Wind gehört ihnen, das Licht des Tages und das Dunkel der Nacht. So ein Mensch war Rosie.“
„Ein Mensch kann alles ertragen. Alles verzeihen. Nur nicht, dass er verachtet wird.“ Doch meist erträgt er auch das – wenn er keine Wahl hat. Davon erzählt Margrit Schriber in Die hässlichste Frau der Welt: Zwei Mädchen, so ungleich wie Tag und Nacht, sind einem Mann ausgeliefert, der sie ausbeutet. Julia, die Affenfrau, ist von so abartiger Hässlichkeit, dass ihr zu jener Zeit nichts anderes bleibt, als sich Kost und Logis als Jahrmarktattraktion zu verdienen, und Rosie wird mit nur 12 Jahren in die große Welt gejagt – ohne Geld und ohne Anhaltspunkt. Was also ist Verachtung im Vergleich zu Hunger? Theodor Fairchild Lent bekommt Bewunderung und sexuelle Gefälligkeiten, so viel er will. Über einen entstellten Menschen zu erzählen, der ob seiner Andersartigkeit als Monstrosität begafft wird, ist nicht neu – aber die Schweizer Autorin Margrit Schriber tut es immerhin auf recht originelle Weise. Sie wählt als Ich-Erzähler den Armenvogt, der so gar nichts mit der Geschichte zu tun hat und dessen Persönlichkeit dürftig bleibt. Er berichtet quasi aus zweiter Hand, was er von Rosie gehört hat – ein Erzählkniff, den ich eher kompliziert und unnötig finde. Völlig überrascht bin ich vom gestelzten und verqueren Stil, der vermutlich das Flair und die Ausdrucksweise des 19. Jahrhunderts wachrufen soll. Vielfach sind die Sätze sehr schön, aber insgesamt zwingen Perspektive und Geziertheit mich, auf Distanz zum Buch zu bleiben. Hauptperson Rosie la Belle wirkt in den Briefen, die sie unverständlicherweise ihrem Ziehvater schreibt, ohne je Antwort zu erhalten, schrecklich naiv und unglaubwürdig klug zugleich. Viel Gefühl bringe ich nicht für ihr Schicksal auf. Die hässlichste Frau der Welt hat durchaus faszinierende Aspekte und ist eine kuriose Mischung aus Märchen, Geschichtsexkurs und Gesellschaftsstudie. Ich hab es gern gelesen, aber das Feuer der Begeisterung hat sich nicht entzündet.
Durchgekaut und einverleibt. Von diesem Buch bleibt …
… fürs Auge: sehr seltsam, sehr schön.
… fürs Hirn: die Sensationsgier der Menschen.
… fürs Herz: Grausamkeit.
… fürs Gedächtnis: wenig bis nichts.