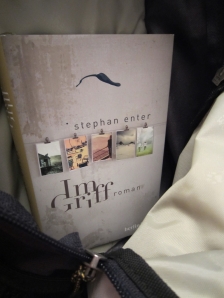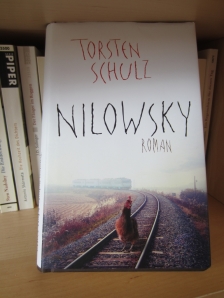„Im Leben gibt es nur zwei Wege. Der eine führt nach oben. Der andere auch. Aber auf dem Umweg über unten“
„Im Leben gibt es nur zwei Wege. Der eine führt nach oben. Der andere auch. Aber auf dem Umweg über unten“
„Sicher ist nur, dass ich in dem Moment, wo ich auf der Welt keinen mehr hatte, hier stecken geblieben bin“ – und zwar in Liberec in Tschechien, wo Fleischman seit seiner Geburt lebt. Seine Eltern sind bei einem Unfall gestorben, und der vulgäre Jégr, ein entfernter Verwandter, hat den Jungen bei sich aufgenommen. Er betreibt das höchste Hotel der Stadt, in dem kaum jemals Gäste schlafen, sich aber dennoch einige schräge Vögel herumtreiben: Patka, der eine vermutlich hochgiftige Substanz als „Happy“-Serum verkauft, der alte Franz, der nach Liberec zurückgekehrt ist, um zu sterben, oder die Zimmermädchen Ilja und Zuzana, von denen eine hinter Fleischman her ist – der sich jedoch nur für die Wetterfee aus dem Fernsehen interessiert. Fleischman hat keine Ambitionen, er schafft es nicht, aus Liberec zu entkommen, und auch die Therapie bei einer Psychologin bringt ihn nicht weiter. Jégr, der ihn einen „unfähigen Einhandflötisten“ nennt, geht ihm mit Bemerkungen wie „Wer Fußball nicht liebt, vögelt nicht“ furchtbar auf die Nerven, er zieht sich zurück in seine eigene Welt, in der er sich am liebsten mit Wetterbeobachtungen beschäftigt und allein ist: „Wenn ich könnte, würde ich für einen Moment alle Menschen ausschalten, damit ich in der Stadt ganz allein sein könnte. Und hören könnte, ob die Stadt ein Herz hat …“
Grand Hotel von Jaroslav Rudiš ist ein skurriles Buch. Ich-Erzähler Fleischman berichtet von seiner Kindheit, die mit dem Tod der Eltern ein abruptes Ende fand, und von seinen Tätigkeiten als Mädchen für alles im Hotel, das die ganze Stadt überragt. Seine Beschäftigung mit dem Wetter ist eine einsame, er hat sich selbst der hübschen Fernseh-Meteorologin versprochen, die natürlich unerreichbar bleibt – seine Briefe an sie werden stets nur mit Autogrammkarten beantwortet. Seine Anekdoten über das Leben im fast leerstehenden Hotel sind ein Sammelsurium aus lustigen Begebenheiten, schrägen Dialogen und traurigen Einblicken in das Leben von einem, der eigentlich nur jeden Tag herumbringt, ohne zu wissen, wohin das Leben ihn führen soll. Deshalb führt es ihn auch nirgendwohin, und ich gestehe, dass ich zwischendrin ein bisschen das Interesse verliere an dieser Selbstdarstellung eines niedergeschlagenen jungen Mannes. Generell aber habe ich das Buch des tschechischen Autors gern gelesen, weil es eine gute Mischung aus absurd, witzig und melancholisch bietet.
Durchgekaut und einverleibt. Von diesem Buch bleibt …
… fürs Auge: nun ja … ein schönes Blau immerhin.
fürs Hirn: dass einem manchmal das Leben zu eng werden kann.
… fürs Herz: keine Lovestory, nur eine schwache Schwärmerei.
… fürs Gedächtnis: für mich nicht allzuviel.