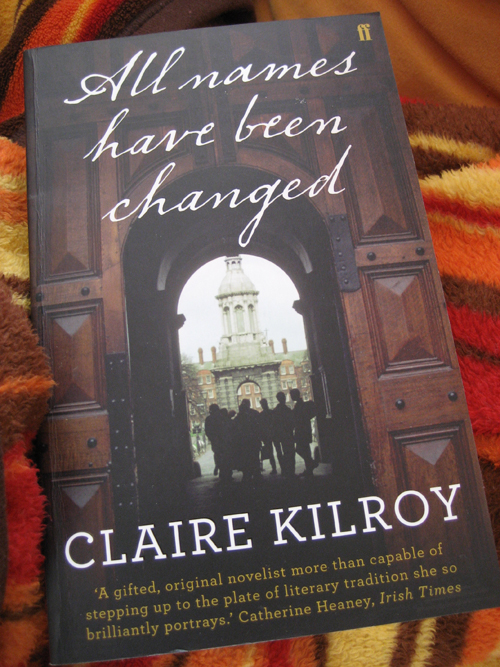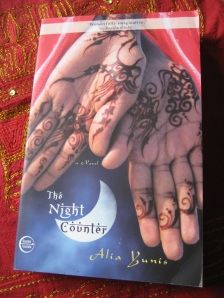 Billiger Ramsch aus dem arabischen Trödelladen
Billiger Ramsch aus dem arabischen Trödelladen
Seit 992 Nächten bekommt die 82-jährige Fatima Abdul Aziz Abdullah Besuch von der unsterblichen Scheherazade. Im Libanon geboren, lebt Fatima in Amerika, seit sie 17 ist. Nacht für Nacht erzählt sie Scheherazade eine Geschichte – meist von ihrem Elternhaus in Deir Zeitoun. Welchem ihrer zehn Kinder oder ihrer vielen Enkelkinder sie dieses Haus vererben soll, weiß Fatima auch nach 992 Nächten noch nicht. Dabei läuft ihr die Zeit davon, denn nach der 1001. Nacht – davon ist Fatima überzeugt – wird ihr Leben zu Ende sein. Und sie muss noch so viel erledigen: ihren Enkel Amir, bei dem sie seit ihrer Scheidung von Ibrahim vor Kurzem wohnt, muss sie verheiraten und von der absurden Vorstellung heilen, er sei homosexuell. Dieser versucht seinerseits sein Glück als Schauspieler, wird aber nur für Terroristenrollen gecastet – weshalb ihn sein Aussehen ins Visier des FBIs rückt. Scheherazade besucht nach jeder von Fatimas öden Geschichten eines ihrer Kinder und besieht sich deren Leben.
The Night Counter – zu Deutsch unter dem Titel Feigen in Detroit veröffentlicht – ist ein leider völlig missratener Roman, bis zum Platzen angefüllt mit Klischees über Menschen arabischer Herkunft. Hauptfigur Fatima ist alt, egozentrisch, stur und intolerant. Die Homosexualität ihres Enkels ist ihr ein Gräuel – in ihren Augen verboten vom Koran – und als ihre siebzehnjährige Urenkelin schwanger und hilfesuchend vor der Tür steht, will sie nicht einmal mit der Sünderin reden. Sie ist dermaßen antiquiert und unsympathisch, dass ich sie während der Lektüre innerlich mehrmals eine blöde Kuh schimpfe. Dass Alia Yunis mir weismachen will, das FBI verfolge wegen eines anonymen Tipps ernsthaft einen ab und zu als Terroristen verkleideten Schauspieler, finde ich fast schon ärgerlich. Noch schlimmer aber ist ihre Darstellung von Scheherazade, die – beladen mit klimperndem Goldschmuck – am liebsten nur schlüpfrige Geschichten hören würde und tatsächlich mit einem fliegenden Teppich unterwegs ist. Das ist nicht amüsant, sondern einfach nur lächerlich. Mit diesem extrem klischeehaften Fluggerät sucht sie Fatimas Kinder – zum Glück nicht alle zehn! – auf, die sie natürlich nicht sehen können. Es folgen endlose und uninteressante Beschreibungen über den Alltag dieser verschiedenen Figuren, die ich irgendwann aus Langeweile nur noch querlese. Alia Yunis schürt mit der Erfindung der ewig gestrigen Fatima das Feuer, alle Muslime seien radikal, uneinsichtig, seien gegen Homosexualität und wilde Ehe und unwillig, sich zu integrieren. Nach fast sieben Jahrzehnten in Amerika spricht sie noch immer nicht gut Englisch. Sie hängt sich mit aller Macht an die Erinnerungen aus ihren ersten 17 Lebensjahren. Ihre Kinder halten kaum Kontakt zu ihr, und dass sie sich von Ibrahim getrennt hat, kann ich nicht nachvollziehen. Fatima ist in keiner Hinsicht etwas Besonderes – genau wie dieses Buch.
Durchgekaut und einverleibt. Von diesem Buch bleibt …
… fürs Auge: das Bild der hennaverzierten Hände ist schön, Autorenname und Buchtitel gehen aber ein wenig unter.
… fürs Hirn: einfach nur ärgerlich, dieser Reigen an uralten Klischees.
… fürs Herz: ach. Nein. Da finde ich nichts.
… fürs Gedächtnis: hoffentlich so wenig wie möglich.