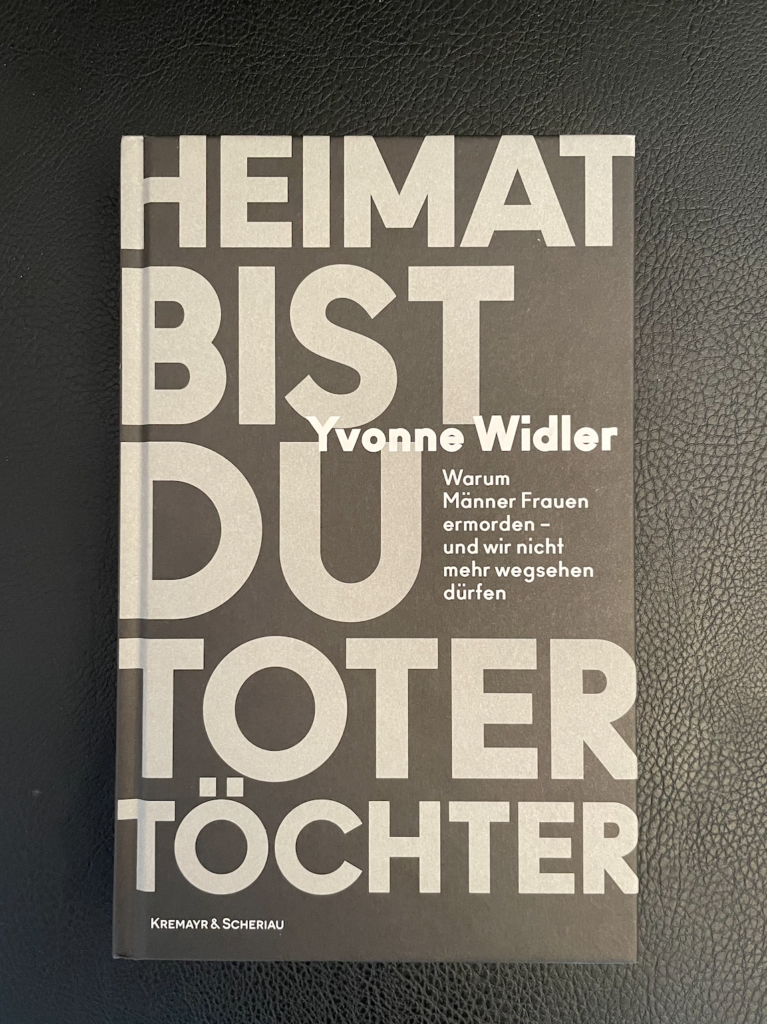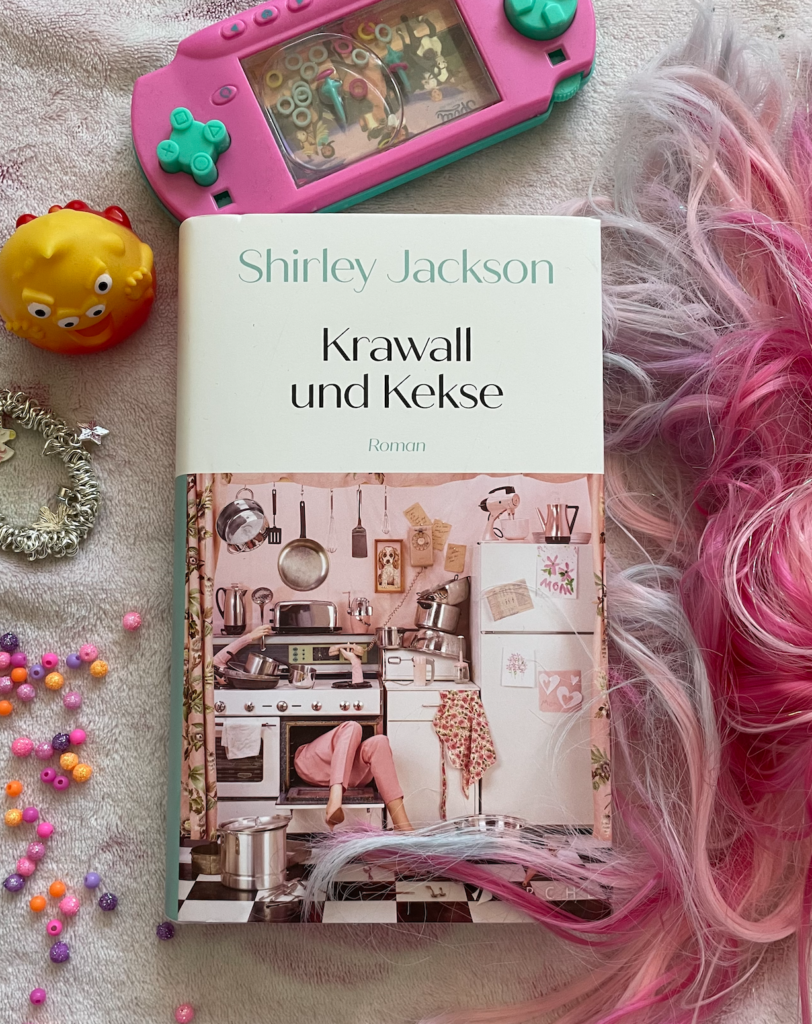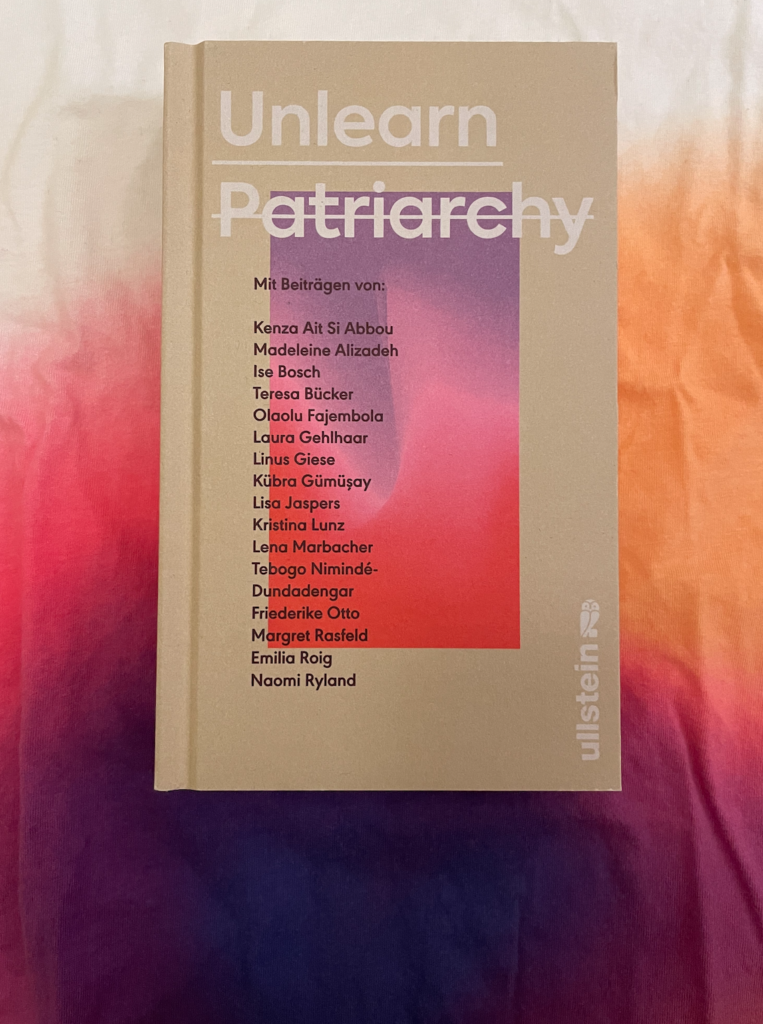„Einem Verständnis dafür, wie es sich anfühlt, ein anderes Tier zu sein, sind wir heute näher als je zuvor …“
„… aber wir haben es anderen Tieren auch schwerer als je zuvor gemacht, überhaupt zu existieren.“
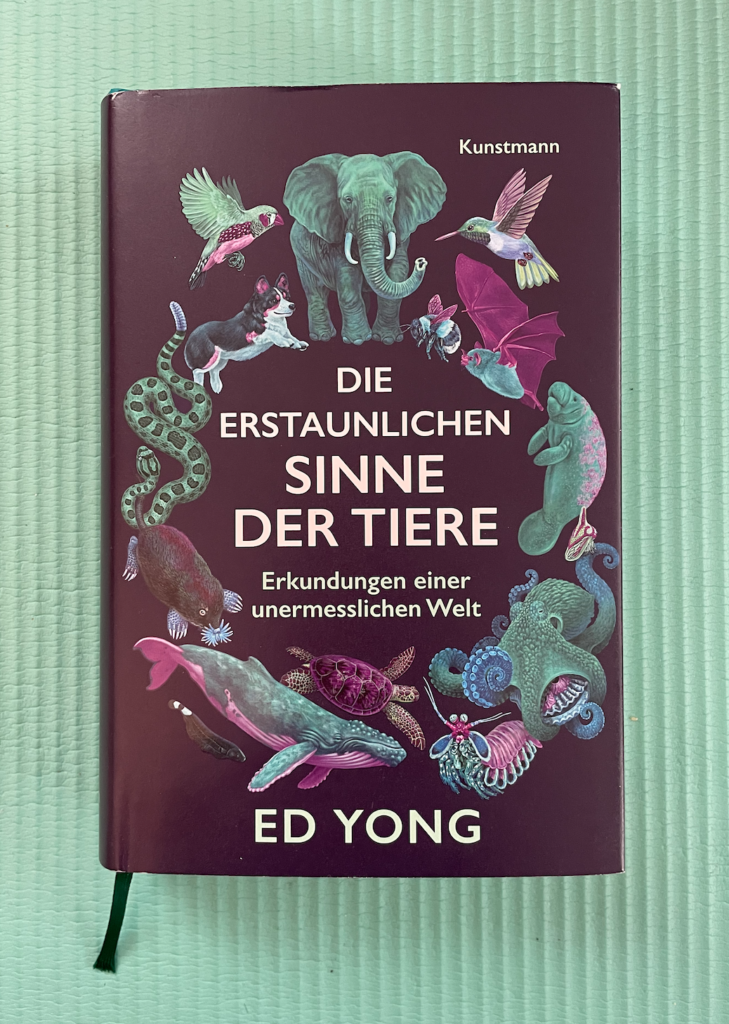
Habt ihr gewusst, dass Schlangen mit der Zunge riechen und ein Wels mit dem ganzen Körper schmecken kann? Dass die Arme eines Kraken teilweise ohne Anweisung vom Gehirn selbstständig auf Erkundungstour gehen können und dass die Rufe der Wale in ruhigeren Zeiten über ganze Ozeane hinweg zu hören waren? Ed Yong erzählt von einer Welt, die unsere ist – und gleichzeitig nicht: Der Wissenschaftsjournalist hat sich der tierischen Sinnesorgane angenommen und zeigt, wie Hummeln Blüten wahrnehmen, dass Vögel sehr wohl riechen können und dass Manatis sich mit den Lippen begrüßen. Dabei berichtet er in der Ich-Form, wie er diese Informationen zusammengetragen und mit welchen Expert:innen er gesprochen hat. Für meine Kinder, mit denen ich dieses Buch teilweise gemeinsam gelesen habe, war es immer wieder erstaunlich, zu erfahren, welche Berufe Menschen haben können: Die einen beschäftigen sich mit Elefantendung, die anderen machen Experimente mit Jakobsmuscheln, um deren Hunderte Augen zu testen. Als Gute-Nacht-Geschichte musste ich filtern, weil das Buch für Kinder freilich zu kompliziert ist – aber sie fanden es so spannend, dass sie trotzdem weiterlesen wollten. Das Fazit ist rasend traurig, denn um die vom Menschen verursachte Umweltzerstörung kommt Ed Yong nicht umhin: Da wir den Lebensraum vieler Tiere verschmutzen und verändern, sind sie bedroht. An viele dieser Veränderungen kann eine Art sich nicht gewöhnen, weil sie zum Beispiel rein organisch nicht in der Lage sind, gewisse Signale zu hören oder zu sehen. Bei über 500 Seiten über die Vielfalt des Tierreichs ist es besonders schmerzhaft, darüber nachzudenken, dass wir Menschen Lebewesen umbringen, die sich über Jahrmillionen entwickelt haben. Ein hochinteressantes, sehr informatives Buch – das euch vieles über Tiere verrät, was ihr garantiert noch nicht wusstet.