Wer hier mitliest, weiß: Ich bin in diesem Jahr ein bisserl ungustelig. Ich hab einen extrem schlechten Lauf und motze deswegen mehr rum als normalerweise, aber in Anlehnung an den klassischen Schlussmachsatz sei gesagt: Es liegt NICHT an mir! Sondern an den Büchern. Die find ich einfach nicht gut, und ein bisserl hab ich auch das Blümchenbloggerische Bücherliebhaben satt, dieses In-den-Himmel-Loben von Lieblingstiteln und Unter-den-Tisch-fallen-Lassen von allem, was nicht ach so toll war. Heute trifft’s erneut zwei hochgelobte Titel, die allerhand gute Kritiken eingeheimst haben und die ihr vielleicht auch kennt.
 Elizabeth Strout: Die Unvollkommenheit der Liebe
Elizabeth Strout: Die Unvollkommenheit der Liebe
Ach, Elizabeth! Es hat so gut mit uns angefangen. Ich hab dein Buch Olive Kitteridge gelesen, und es war wunderbar. Aber dein jetziger Roman, was soll das sein? Der weinerliche Monolog einer langweiligen Frau, die monatelang im Krankenhaus liegt und nichts zu tun hat, im Ernst? Lucy erinnert sich an ihre Kindheit, weil ihre Mutter an ihrem Krankenbett sitzt, und schön war diese Kindheit nicht. Seltsam vage, verschwommen und distanziert sind diese Erinnerungen, und aus der Gegenwart will die Kranke nicht viel verraten. Wozu redet sie dann überhaupt mit mir? Das Buch ist der Bericht einer Fremden, kein Einblick in das Innerste einer Figur, eine Studie, als wäre es noch kein fertiger Roman. Ich hab es nur gelesen, weil ich im Flugzeug saß und sich die anderen Bücher im Koffer befanden. Im Lagerraum. Es hat mir die Zeit vertrieben, sonst jedoch nichts. Obwohl es ausschließlich von Emotionen handelt, legt es sie derart unbeteiligt auf den Tisch, dass keine von ihnen zur Geltung kommen kann. Elizabeth, was ist passiert? Was ist das für eine schmale Abhandlung, so leblos, fad und ohne einen einzigen golden glänzenden Satz? Ach, und dabei hat es so gut angefangen mit uns.
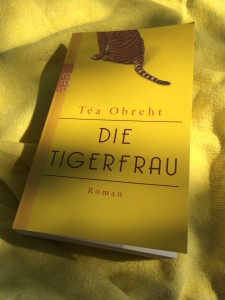 Téa Obreht: Die Tigerfrau
Téa Obreht: Die Tigerfrau
Ein Buch, das um die Welt ging – und überall wohlwollend aufgenommen wurde. Es geht darin um den Krieg im damaligen Jugoslawien, um eine junge Frau, die ihren Großvater betrauert, und um einen Tiger. Nun ist euch ja von vornherein klar, dass ich den Roman nicht sonderlich mochte, weil ich ihn hier eingereiht habe, aber die Frage ist natürlich: Warum nicht? Zum einen: Mir fehlte der Zauber. Der Krieg, der hatte nicht den geringsten Zauber, natürlich nicht, aber die Erinnerungen an den Großvater hätten ihn haben können. Seit ich Wie der Soldat das Grammofon repariert von Saša Stanišic gelesen habe, vergleiche ich alle Bücher über diesen Krieg damit, und sie verlieren, eins nach dem anderen. Das ist nicht fair, aber er hat vorgemacht, wie’s geht, und bisher hat es ihm keiner nachmachen können. Bei Téa Obreht bekomme ich irgendwann den Eindruck: Die Aufmerksamkeit hat sie auch nur deshalb auf sich gezogen, weil sie als Einwandererkind den tabuisierten Jugoslawienkrieg thematisiert und weil sie was Mystisches reinspritzt, was Altes, Unheimliches, das irgendwie gewichtig wirkt. Aber die Geschichte mit dem Tiger – sie hat für mich keine Botschaft. Sie ist gut und lesbar, einen Zusammenhang zu den Teilen in der Gegenwart hat sie nicht. Überhaupt: die Zeitebenen. Téa Obreht mischt und springt wild hin und her, bricht alles auf, wechselt von einem Kapitel zum anderen Zeit und Perspektive ohne Marker, an denen ich mich orientieren könnte. Erst nach der Hälfte des Buchs hab ich beispielsweise kapiert, dass „mein Großvater“, wie er immer heißt, in manchen Kapiteln erst elf Jahre alt ist. Vielleicht denkt ihr jetzt, ich sei eben nicht schlau genug, aber im Ernst: Soll das ein Buch interessanter machen, wenn der Leser sich nicht auskennt? Es verwirrt und langweilt mich einfach nur. Zu guter Letzt hat mich auch die Gefühllosigkeit der Protagonistin gestört. Ihr Opa ist tot, und sie reagiert mit: Aha, who cares. Vielleicht will sie sich vor dem Schmerz schützen. Aber Téa Obreht hätte ihn trotzdem spürbar machen können, darauf habe ich den ganzen Roman über gewartet. Er ist da, er sitzt zwischen den Zeilen, und doch scheint sie ihn zu ignorieren. Hätte ich mit diesem Buch auch machen sollen.