 Stefan Slupetzky: Der letzte große Trost
Stefan Slupetzky: Der letzte große Trost
Daniel erhält einen Brief, in dem es um das Haus geht, das er als Kind mit seinen Eltern und seinem Bruder bewohnt hat. Deswegen fährt er dorthin, taucht ein in die Vergangenheit, findet natürlich was im Keller – dieses altbekannte Setting zielt immer darauf ab, dass das inzwischen erwachsene Kind sich erinnert plus was findet – und stellt darum alles in Frage, was er über den Vater zu wissen glaubt. Er spinnt sich seine eigene Version der Geschichte zusammen, die so absurd wie unglaubwürdig ist. Dann will er das, was er sich da zurechtgedacht hat, auch noch nachmachen, was umso bescheuerter ist. Was ich zudem an diesem Buch nicht mag: dass alles erklärt wird. Also wirklich alles. Wer wann wo geboren ist, was seine Eltern gemacht haben, mit wem er geschlafen hat, blabla schnarch. Es ist viel zu viel tell und viel zu wenig show. Dabei kann Stefan Slupetzky sehr gut schreiben, das wusste ich nach Der Fall des Lemming von 2005, ein origineller Krimi war das, aber was dieser Roman hier sein soll, ich versteh es nicht. Der Versuch, auch mal so eine Geschichte zu schreiben, wie sie jeder schreibt, über den Erwachsenen, der den Nachlass der Eltern durchschauen muss? Ich schwöre mir jedenfalls hiermit selbst, dass ich endlich wirklich, wie schon oft beschlossen, aufhören werde, Bücher mit diesem Handlungsverlauf überhaupt nur in Erwägung zu ziehen. Sie sind alle grottig, alle!
 Castle Freeman: Auf die sanfte Tour
Castle Freeman: Auf die sanfte Tour
Ein sehr ähnliches Problem hatte ich mit diesem Buch: Es erklärt und erklärt und erklärt. Die eigentliche Geschichte geht dabei völlig unter, ich konnte ihr auch nach 80 Seiten nicht auf die Spur kommen und habe – was ich ja nur selten tue – entnervt abgebrochen. Was so ein Deputy macht, wie der Vater seiner Freundin zu ihm steht, wer wann was gesagt hat, all das erfahre ich, aber die Handlung selbst bleibt auf der Strecke. Ich habe absolut nichts gegen sehr männliche, schnörkellose, schlichte Bücher, ich finde Daniel Woodrell gut und Pete Dexter, aber das hier, das ist für mich einfach nur unglaublich öde. So langweilig, dass ich nicht mal mehr wissen wollte, was denn nun eigentlich mit dem an den Baum gebundenen nackten Russen passiert ist. Und das will ja wohl was heißen! Ein Buch, so fad wie ein leiser Furz.
Mark Watson: Hotel Alpha
Das ist kein Buch, über das ich lästern könnte, aber Lobenswertes fällt mir auch nicht viel ein. Es ist wohl das, was man seichte Unterhaltung nennt, es ist nett und harmlos, dabei halt sehr unbedeutend. Mark Watson hat zusätzlich dazu hundert Kurzgeschichten geschrieben, die den „Kosmos des Romans“ erweitern, an denen ich aber null Interesse hatte und über die ich deshalb nichts sagen kann. Hauptfiguren gibt es zwei: Graham, der jahrzehntelang an der Rezeption des Hotel Alpha arbeitet und dem vermeintlichen Zauber des Hauses völlig verfallen ist, und Chaz, der als Kind bei einem Brand im Hotel erblindet und fortan dort aufwächst. Beide bekommen von der Außenwelt wenig mit, eine heile Welt ist die ihre aber auch nicht so ganz. Das alles klingt, als hätte Wes Anderson einen Film darüber machen können, nur wäre der mit Sicherheit viel besser.
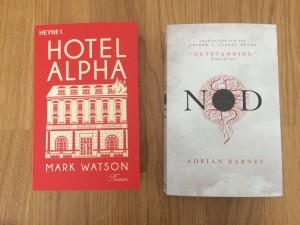 Adrian Barnes: Nod
Adrian Barnes: Nod
Was wäre, wenn die Menschen plötzlich nicht mehr schlafen könnten? Was würde mit ihren Körpern geschehen nach drei Tagen, nach zehn, nach dreißig? Wie würden sie sich verhalten und wann würden sie sterben? Das sind die Fragen, denen sich dieses freakige englische Buch stellt, das mich genau aus diesem Grund interessiert hat. Die Antworten, die es liefert, sind allerdings reichlich enttäuschend, denn der Autor hat das Naheliegendste gemacht, was möglich war: Die Menschen werden nicht unbedingt zu Zombies, aber zu etwas Ähnlichem, sie verfallen dem religiösen Wahn, gründen eine Art Kult. Die Zivilisation zerfällt innerhalb kürzester Zeit, Strom und Internet werden abgedreht, alle plündern, alle morden. Das war zu erwarten, und das finde ich schade – ich hätte mir mehr Originalität erhofft.